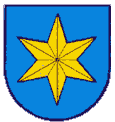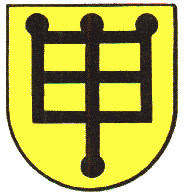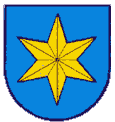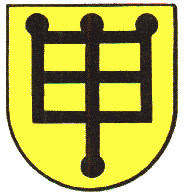Als das Motorenwerk Bad Cannstatt 1996 eröffnet
wurde, galt das neue Werkteil auf dem Gelände
des ehemaligen Ausbesserungswerks der Bahn als die "Fabrik
der Zukunft". Zehn Jahre später hat die
Cannstatter Motorenproduktion nichts von ihrer Innovationskraft
verloren.
Die Vorstellung von an Bändern stehenden
Mitarbeitern, die im Akkord stundenlang die gleichen
Handgriffe erledigen müssen und ölverschmierten
Maschinen, wirft der Besucher schnell über Bord.
Eintönige Arbeiten übernehmen Roboter. "Trotz
der Technisierung sind die Fertigkeiten unserer erfahrenen
Mitarbeiter das Entscheidende", sagt Diplomingenieur
Dieter Nau, der Leiter der Montage im V6/V8-Motorenwerk.
In zwei Linien können in der lichten Halle bis
zu 2600 V-Motoren pro Tag produziert werden. Die
Variantenvielfalt ist immens. So finden sich V6-
oder V8-Motoren, davon jeweils mit unterschiedlichem
Hubraum, Automatik- oder Schaltgetriebe, Allradantrieb
- abhängig von der Ausstattung und dem Fahrzeugtyp
in dem er gefahren wird.
"Jeder Motor ist bei
uns ein Individuum", sagt Nau zu Recht. Bei
jedem beginnt die Geburtsstunde gleich: Ein in der
Mettinger Gießerei gefertigtes Kurbelgehäuse
wird von Robotern auf eine Transportplatte gesetzt.
Auf einem mobilen Datenspeicher sind die Fakten des
gewünschten Motors verschlüsselt. Sofort
erfolgt der erste Test: Der Durchmesser wird vermessen
und geprüft, ob es der richtige Typ ist. Anschließend
wird die fortlaufende Motornummer eingemeißelt.

Dann legen die Blaumänner und -frauen Hand an:
An ergonomischen Arbeitsplätzen werden die Lagerschalen
eingesetzt, die Ausgleichswelle montiert. In einem
Extrabereich werden die Kolben vormontiert. Beim
Einpassen der Kolben und Pleuel dürfen wieder
die eisernen Kollegen mit den zackigen Bewegungen
ran: In atemberaubender Genauigkeit setzen zwei miteinander
kooperierende Roboter haargenau die Motorenteile
an die dafür vorgesehenen Stellen. "Es
geht um Mikrometer-Arbeit, ohne einen Kratzer zu
erzeugen", beschreibt Nau die Aufgabe der Roboter.
Eine Anzeigentafel zeigt in roten Zahlen an, wie
die Mitarbeiter im "Trend" liegen: Plus
2. Die Produktion liegt etwas besser als die Vorgabe.
Operation am offenen Herz
Der Motor wandert
weiter. Stück für Stück wird er bestückt.
Mit dem Kettentrieb und der Ölpumpe. Vollautomatisch
wird das Steuergehäuse montiert. Einige Schritte
weiter drehen Roboter im Takt Schrauben in die mit
Silikon beschichtete Ölwanne. "Jetzt folgt
einer der kompliziertesten Schritte", macht
Nau auf die Vereinigung von Motor mit den Zylinderköpfen
aufmerksam.
"Eine Operation am offenen Herzen
des Aggregates."
Ummantelt von Scheiben, übernehmen
wieder Roboter die äußerst komplexen Vorgänge.
Die "Werker" rüsten den Motor weiter
mit peripheren Teilen aus: Ölabscheider, Kabelsätze, Ölmessstabführungsrohr
und anderes. Jeder Handgriff sitzt. Ein ausgeklügeltes
System sorgt dafür, dass der per Datenspeicher
codierte Motortyp mit dem richtigen Teil ausgerüstet
wird. Immer wieder werden die Zwischenprodukte geprüft:
Von Computern wird das neu eingebaute Teil fotografiert
oder vermessen und in Sekundenschnelle mit den Vorgaben
verglichen.
"Wir setzen auf 100-prozentige Qualität",
sagt Nau. Nach etlichen Zwischenchecks wird das Endprodukt
nochmals auf Herz und Nieren getestet, auf Dichtigkeit
geprüft und dann auf dem Kalttest-Prüfstand
der abschließenden Funktionsprüfung unterzogen.
Erst wenn der Teststand für alle Funktionen "In
Ordnung" meldet, wandert der Motor zur letzten
Station: Der gefertigte Motor wird von der Transportplatte
getrennt. Etwa 4,5 Stunden sind vergangen. Das Kraftpaket "made
in Bad Cannstatt" ist für den Transport
und den Einbau in die Karosserie bereit.