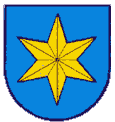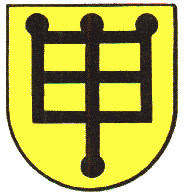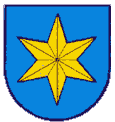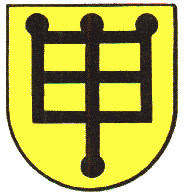Bad Cannstatt
Vor 125 Jahren hat die Geschichte des Automobils begonnen-mit einer Motorradfahrt.
Von Lukas Jenkner
Der Termin ist schlau gewählt: Am 10. November 1885 sind die Straßen Cannstatts und Untertürkheims halbwegs leer, weil sich alle Welt versammelt hat, um Friedrich Schillers Geburtstag zu feiern. Wenn der Versuch schief geht, fällt es wenigstens nicht allzu sehr auf, haben sich Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach womöglich gedacht. An jenem Tag soll nun an die Öffentlichkeit, woran sie unter strengster Geheimhaltung in der kleinen Werkstatt nahe der Daimler-Villa und des Kursaals gearbeitet haben: Ein mit einem Benzinmotor ausgestatteter Reitwagen, den Daimlers 16 Jahre alter Sohn Paul von Cannstatt nach Untertürkheim lenken soll.
"Es war Paul und nicht Adolf", sagt Gunter Haug. Der gebürtige Cannstatter, der in Untertürkheim aufgewachsen ist, hat eine Romanbiographie über Gottlieb Daimler verfasst, dafür im Konzernarchiv in Untertürkheim recherchiert und unter anderem herausgefunden, dass nicht, wie die vergangenen hundert Jahre behauptet, Adolf gefahren ist, sondern Paul. Jener Junior, sagt Haug, habe später die Anekdote erzählt, dass er mit der "Höllenmaschine" auf dem Untertürkheimer Bahnhofsvorplatz endlos im Kreis gefahren sei, bis das Benzin alle war - er habe einfach nicht gewusst, wie der Reitwagen abzustellen gewesen sei. Erzählt wird außerdem, dass die Fahrt im Wortsinn ziemlich "heiß" gewesen sein soll, weil der Daimlersche Benzinmotor unter dem Sitz eingebaut worden war.
 Dass sich Gottlieb Daimler ausgerechnet in Bad Cannstatt ansiedelte, nachdem er sich in Köln beim Motorenhersteller Deutz mit Nicolaus Otto überworfen hatte, verdankt die Bäderstadt ihren Mineralquellen, erzählt Hans Betsch, der Vorsitzende des Vereins Pro Alt Cannstatt. Das heilende Wasser und die große Zahl am Ort ansässiger Ärzte habe Gottlieb Daimler im Jahr 1882 nach Cannstatt gelockt.
Dass sich Gottlieb Daimler ausgerechnet in Bad Cannstatt ansiedelte, nachdem er sich in Köln beim Motorenhersteller Deutz mit Nicolaus Otto überworfen hatte, verdankt die Bäderstadt ihren Mineralquellen, erzählt Hans Betsch, der Vorsitzende des Vereins Pro Alt Cannstatt. Das heilende Wasser und die große Zahl am Ort ansässiger Ärzte habe Gottlieb Daimler im Jahr 1882 nach Cannstatt gelockt.
In der dortigen Versuchswerkstatt ging es dann zügig voran, auch wenn der Weg steinig war. "Da sind ihm und Wilhelm Maybach manches Mal die Fetzen um die Ohren geflogen", sagt Betsch. Doch 1885 war Daimler seinem Ziel, einem kleinen, schnell laufenden und überall einsetzbaren Verbrennungsmotor, so nahe, dass er einen Motor versuchsweise in einen Reitwagen einbaute. Der Rest ist Geschichte, die drei Kilometer lange Fahrt von Daimler Junior, die am Werkstatthaus begann und in Untertürkheim endete, war ein voller Erfolg. Obwohl die Straßen ziemlich leer waren, erzählt der Buchautor Gunter Haug, habe das laute und stinkende Gefährt wohl doch kein geringes Aufsehen erregt. Die schwarzen Rauchwolken seien kaum zu übersehen gewesen. Anfänglich, als die Obrigkeit in den motorisierten Gefährten vor allem ein öffentliches Ärgernis sah, benötigte Daimler für jede weitere Fahrt eine polizeiliche Genehmigung.
Dies motivierte den Erfinder, seinen Motor auch in ein Boot einzubauen, mit dem er ungehindert auf dem Neckar schippern konnte. Und in die Luft fand der Motor seinen Weg ebenfalls: Am 10. August 1888 stieg am Seelberg in Cannstatt zum ersten Mal ein Ballon mit Gondel auf, unter dem ein Daimler-Motor tuckerte. Die Historiker Olaf Schulze und Manfred Schmid, die die im Sommer gelaufene Ausstellung "Vom Wasen zum Mars" konzipiert hatten, sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich um die Geburtsstunde der motorisierten Luftfahrt handelte. "Zu Lande, zu Wasser und in der Luft sollten Daimler-Motoren im Einsatz sein", sagt Hans Betsch. Darauf beziehen sich die drei Zacken im Stern, der schließlich zum Markenlogo von Daimler wurde.
Bereits 1887 hatte Gottlieb Daimler seine Fabrik in Cannstatt gegründet, die 1890 in Schwierigkeiten geriet, weil sie nicht genügend Fahrzeuge liefern konnte. Allerdings dauert es noch 14 Jahre, bis 1904 das Motorenwerk in Untertürkheim offiziell seinen Betrieb aufnahm - mit dem Umzug der Verwaltung von Cannstatt nach Untertürkheim. Produziert wurde in dem heutigen Stammwerk bereits von Dezember 1903 an, nachdem im Juni die Montagehalle in Cannstatt niedergebrannt war und 90 produzierte Fahrzeuge ein Raub der Flammen geworden waren.