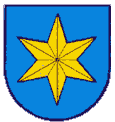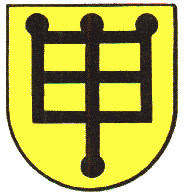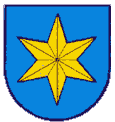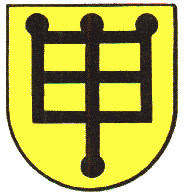Von Mathias Kuhn
Der Verbrennungsmotor schaffte 1883 im Cannstatter
Gartenhaus von Gottlieb Daimler seinen Durchbruch.
In den folgenden Jahrzehnten wurden die Automotoren
weiterentwickelt. Stets haben neue Erfindungen Kühlung,
Zündung, Vergaser- und Kompressortechnik verbessert.
Etliche Meilensteine aus dem Hause Daimler-Benz haben
die Leistungsfähigkeit und Qualität der
Motoren optimiert. Die heutige Motorengeneration
ist mit Daimlers erstem Antrieb, den er in ein Reitrad
einbaute, nicht mehr vergleichbar. „Die Forschung
und Entwicklung geht jedoch weiter“, sagt Leopold
Mikulic, der Leiter Entwicklung Pkw-Motoren und Triebstrang
der Mercedes Car Group. Ingenieure seien kreative
Wesen, deren Ideen gesammelt werden. Technische, ökologische
und wirtschaftliche Gründe sowie Kundenwünsche
treiben Ingenieure in der Untertürkheimer Motorenentwicklung
zu neuen zukunftsweisenden Technologien an. Die neue,
die zweite Generation der Benzindirekteinspritzer
für die aktuellen V6-Motoren ist ein Beispiel,
bei dem es gelungen ist, bei gesteigerter Leistung,
den Kraftstoffverbrauch nochmals entscheidend zu
reduzieren. Zudem werden Ideen von Mitarbeitern,
Zulieferern oder Universitäten aufgegriffen
und in einem abgestuften Verfahren zunächst
auf ihre prinzipielle und später auf ihre Serien-Tauglichkeit überprüft.
Anstatt am Zeichenbrett wie zu Gottlieb Daimlers
und Wilhelm Maybachs Zeiten sitzen heute die Ingenieure
vor Computern mit speziellen rechnergestützten
Konstruktionsprogrammen. „Mit diesen aufwändigen
CAD-Programmen werden nicht nur technische Zeichnungen
erstellt, sondern es können auch dreidimensionale
Volumenmodelle oder Oberflächen visualisiert
werden“, erklärt Mikulic den technischen
Wandel. Die Entwickler können das Modell virtuell
von allen Seiten betrachten.
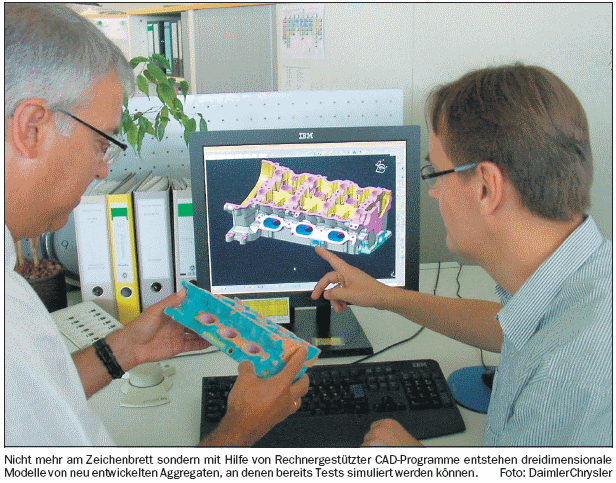 Die Möglichkeiten der EDV haben das Konstruktionswesen
revolutioniert. Natürlich könne man das
CAD-Modell beliebig oft ausdrucken oder an Kollegen
verschicken, die am Entwicklungsprojekt beteiligt
sind. Je nach Umfang des Neukonzepts besteht eine
Motoren-Entwicklungsmannschaft aus einem Kernteam
von 60 bis 80 Experten, die von weiteren Kollegen
Unterstützung erfahren. Teilweise werden in
dieser frühen Projektphase bereits potenzielle
Zulieferer in den Entstehungsprozess miteingebunden.
Das Entwicklungsteam kann mit diesem digitalen Modell
weiterarbeiten, es variieren und sogar ersten Tests
unterziehen. Mit Hilfe weiterer Spezialprogramme
können die Ingenieure bereits während dieser
virtuellen Entwicklungsphase verschiedene Simulationen
durchführen. Stück für Stück
entsteht so aus dem dreidimensionalen Grobmodell
auf dem Bildschirm der erste digitale Prototyp.
Die Möglichkeiten der EDV haben das Konstruktionswesen
revolutioniert. Natürlich könne man das
CAD-Modell beliebig oft ausdrucken oder an Kollegen
verschicken, die am Entwicklungsprojekt beteiligt
sind. Je nach Umfang des Neukonzepts besteht eine
Motoren-Entwicklungsmannschaft aus einem Kernteam
von 60 bis 80 Experten, die von weiteren Kollegen
Unterstützung erfahren. Teilweise werden in
dieser frühen Projektphase bereits potenzielle
Zulieferer in den Entstehungsprozess miteingebunden.
Das Entwicklungsteam kann mit diesem digitalen Modell
weiterarbeiten, es variieren und sogar ersten Tests
unterziehen. Mit Hilfe weiterer Spezialprogramme
können die Ingenieure bereits während dieser
virtuellen Entwicklungsphase verschiedene Simulationen
durchführen. Stück für Stück
entsteht so aus dem dreidimensionalen Grobmodell
auf dem Bildschirm der erste digitale Prototyp.
„Zeitgleich wird bereits ein Konzeptheft erstellt,
in dem wir den Motor beschreiben, die technischen
Inhalte darlegen und definieren“, erklärt
Mikulic. Immer wieder werden die Zwischenergebnisse
diskutiert, Neuerungen eingearbeitet, weiterführende
Aufträge erteilt und die Innovation so etappenweise
verfeinert. Maximal zwei Jahre sind seit der ersten
Idee bis zum verfeinerten digitalen Modell und zum
detaillierten Konzeptheft vergangen, doch noch fehlt
der Neuerung der entscheidende Schritt. „In
einem finalen Beschluss muss vom Vorstand die Produkttauglichkeit
entschieden werden“, so Mikulic. Die Zustimmung
ist der Start für den seriennahen Entwicklungsbetrieb.
Dann gilt es, das neue Aggregat auf Herz und Nieren
zu prüfen, sich Gedanken über die baulichen
Konsequenzen einer neuen Motorengeneration zu machen
und mit den Zulieferern die Produktion und Produktionsplanung,
aber auch die qualitätssichernden Maßnahmen
abzustimmen. Hierbei werden alle Komponenten bereits
in der digitalen Phase durch Produktaudits und Risikoanalysen
eingehend geprüft. Außerdem werden die
geplanten Produktionsprozesse intensiven Checks unterzogen,
um kritische Themen im Fertigungs- und Montageprozess
möglichst früh zu identifizieren und abzustellen.
So wird sichergestellt, dass später Produkte
mit höchster Qualität die Werke verlassen.