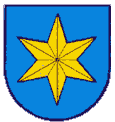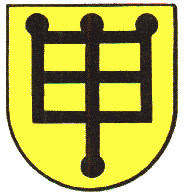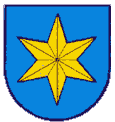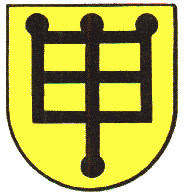Bernd Dangelmaier - Jahrgang 1944 - wuchs in Untertürkheim auf und lebt jetzt in Rohrdorf bei Nagold
Inselbad, 1950 - 1960
Wer mit der Straßenbahn kam, benutzte entweder die 4, die 13, oder die 23. Auf der Pappelallee oder
diversen Treppen hinunter zum Parkplatz, da standen nur wenige Autos und jedes wurde bewundert. Im
hinteren Bereich dann der bewachte Radabstellplatz. Unter Wellblechdächern Rinnen zum Hochstellen
und eine Platzmarke zum Einlösen, alles was leicht abzumontieren war, nahm man aber besser mit. Das
kostete eine Kleinigkeit, wurde aber viel benutzt, da schon damals die meisten Fahrraddiebstähle am
Schwimmbad erfolgten.

Selbstverständlich hatten wir eine Jahreskarte und waren im Sommer so oft wie möglich dort. Wer keine
Karte hatte, aber zumindest schon schwimmen konnte, der fand auch einen Weg über den Neckar oder
Kanal. In den ersten Jahren gab es noch einen Bootsverleih innerhalb des Bades am Neckarufer, so dass
auch ein Fährdienst eingerichtet werden konnte. Es war sogar möglich, ca. 20 Meter unterhalb des
Wehres in teilweise brusttiefem Wasser den Neckar zu durchschreiten. Der lange Kabinenblock bestand
aus Sammelkabinen, Einzelkabinen und auf dem „Oberdeck“ sogar Tageskabinen für die „Millionäre“.
Diese konnten auch vorne in der Gaststätte speisen, unsereins holte sich dort mal eine „Rote Wurst“ oder
ein Eis am Stiel (nur Vanille oder Schokolade in Staniolpapier).
In jungen Jahren wurde ich natürlich dem Kinderbecken zugeordnet. Ein Balkenkarussell in der Mitte
zwang, mit Höchstgeschwindigkeit geschoben, so manches Kind zum unfreiwilligen Untertauchen. Es
war das wärmste Becken, was allerdings nicht durch eine Wasserheizung erreicht wurde. Sicherlich
wurde das gelblich, trübe Wasser täglich ausgetauscht. Es folgte eine Steinplattenliegefläche, wie sie auch
zwischen den anderen Becken und am Rand oft vorhanden war. Die Platten waren angenehm warm, aber
sie rochen immer recht verpinkelt, was nicht nur von dem Wasser des Kinderbeckens kommen konnte.
Die kleine Rutschbahn und eine breite Treppe führten dann ins Familienbecken, das war sehr groß und
natürlich auch kälter. Hinten, wo es in den tieferen Schwimmerbereich, war am Grund ein quer
verlaufender Plattengang mit Grifflöchern. Schon als Nichtschwimmer war es mir möglich, mich
tauchend am Grund handübergreifend bis zur anderen Seite zu ziehen. Am tiefen Ende dann die große
Rutschbahn und zwei Sprungbretter. Nach einem weiteren Steinplatten-Trockenplatz, der auch als
Anlaufstrecke für Extremweitsprünge genutzt wurde, ein Stück Liegewiese und das Schülerbecken.
Dieses hatte eigentlich keine Besonderheiten und wurde auch von Schülern kaum benutzt.
Nur eine Mauer mit Startklötzen trennte es vom „Startbecken“ mit seinen eingeteilten Wettkampfbahnen.
Es hatte 50 Meter Länge und wurde auf der tieferen Seite auch nur durch eine Trennmauer vom
Sprungbecken abgeteilt. Von den Klötzen konnte man auch in das jeweils falsche Becken rein springen,
was eigentlich verboten war. Für uns waren nur die Eckbereiche der letzten Becken interessant. Hier
wurde gerne über Eck ein Fangenspiel gemacht, wie auch oftmals an den anderen Becken, selbst die
Nichtschwimmer konnten diese Kurzstrecken überbrücken.
Das fünf Meter tiefe Sprungbecken war für mich ein weiteres Tauchrevier. Auf einer Seite runter tauchen,
unten auf die andere Seite und dort wieder hoch. Wer so was konnte, der war auch in der Lage, ab und zu
sein Taschengeld auf zu bessern, denn am Grund lagen oftmals Münzen. Das war jedoch nur gestattet,
wenn der Turm mit seinen 5 und 10 Meter Plattformen gesperrt war. Diesen mutigen Gesellen haben wir
auch des Öfteren zugeschaut. Wie sie zaghaft vorne an den Rand traten und der Bademeister
vorsichtshalber den Abstieg zustellte. Ein „Bauchpflatscher“ aus dieser Höhe konnte schlimm enden.
Später sprang ich nach dem 3 Meter-Brett auch mal vom Fünfer, aber dann war Schluss.
Es gab noch eine weitere Wasserfläche um diese fünf Becken, das waren die Fußwaschrinnen. Hier konnte
man, zu zweit oder dritt nebeneinander gehend, wunderbare Wellenberge vor sich her schieben, die
heutigen Ozeanriesen wären vor Neid erblasst. Es störten nur immer die Stahlrohrabsperrungen
zwischendrin. Manchmal lag auch ein Kind in der Rinne, dass dann vom Ertrinken gerettet werden
musste.
Hinter dem Sprungturm führte eine Böschung hinunter zur „Liebesinsel“. Diese Bezeichnung hatte sie
wohl seit Anfang an, und jede Generation war bemüht, diesen Namen zu bestätigen. Für uns jungen „Nichtliebenden“ war das Hängekarussell wesentlich verlockender. An den Ketten hingen Holzknüppel
zum Festhalten und dann wurde mit Anlauf um die Haltestange im Kreis herum geschwungen. Vorsicht
beim Aussteigen, die leeren Knüppel kreisten meist in Kopfhöhe. Das Ende der Insel, wo Neckar und
Kanal zusammen trafen, war auch recht interessant, aber da störte unsereins nur die Namensgeber.
Wenn wir nun am Kanal aufwärts gehen, dann stehen hier jene Bäume, von deren weit ausladenden Ästen
man in den Kanal rein springen konnte. Das taten die Balzhähne natürlich auch, schwammen in der
starken Strömung zum Daimler rüber und nach einer Ruhepause wieder zurück. Weiter oben dann die
Bretterwand und dahinter das Becken für Schwerbeschädigte. Entgegen weitläufiger Meinung war das
Wasser nicht wärmer als anderswo, wir haben es ausprobiert. Heute ist es ein FKK-Bereich und damit für
die Kinder genau so interessant wie früher.
Hier war dann kein Weiterkommen mehr, man musste auf die andere Seite des Kabinenblockes und ganz
zum Eingang vor laufen, nur so kam man in das abgeschirmte „Frauenbad“. Zu meiner Zeit hatte diese
Trennung allerdings schon keine Bedeutung mehr, aber das könnte bei den heutigen Bewohnern
Untertürkheims bald wieder kommen. Wir hatten in diesem Becken auch unseren Schwimmuntericht. Ein
Schüler wollte mal im niedrigen Bereich rückwärts rudernd ertrinken, Herr Achatz rettete ihn rechtzeitig.
Im Neckar wurde damals auch noch manchmal geschwommen und es gab dort immer wieder Stellen, an
denen man stehen konnte. Beim Bau der Schleuse holten wir uns auf der Baustelle die Schalungsbretter
und schipperten mit diesen auf dem Neckar rum. Interessant waren auch die jährlichen Überschwemmungen, wenn das Wasser über dem Plattenweg am Ufer stand und die „Liebesinsel“ immer
kürzer wurde. Der Neckardamm wurde auch beidseitig als Liegewiese benutz. Irgendwann hatte ja jede
Clique einen Stammplatz, der nicht so im Blickfeld lag. Allerdings rutschte man da ständig bergab, nur
unten am Weg war gut liegen.
In den letzten Jahren wurde der Schwimmbadparkplatz auch als Festplatz benutzt. Nur ungern erinnere
ich mich an meine zu schnelle Fahrt mit dem Überschlagkäfig. Als es vorne runter ging, hing ich kurz in
der Luft und wurde beim unteren Zurückschwenken an das vordere Gitter geschmettert. Es war nur die
Nase und mein Image etwas gebrochen.
Bernd Dangelmaier, im Januar 2010